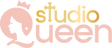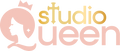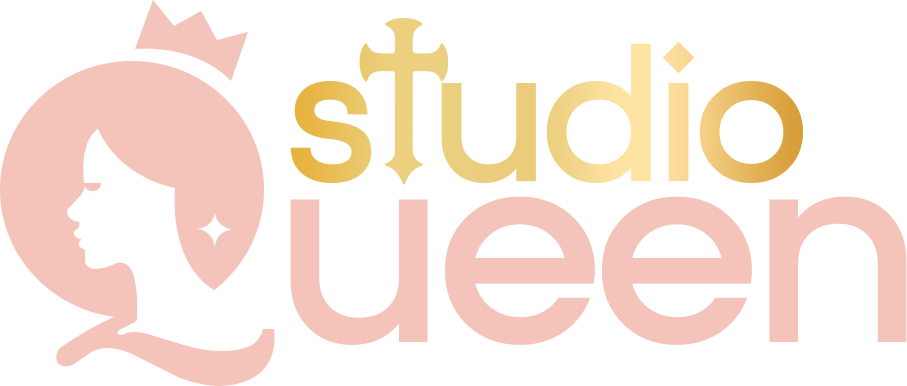Warum die Säuglingstaufe falsch ist
Die Taufe ist ein bedeutender Ritus im Christentum und symbolisiert den Glauben und die Hingabe eines Gläubigen an Jesus Christus. Obwohl die Praxis der Säuglingstaufe in vielen christlichen Konfessionen weit verbreitet ist, gibt es zunehmende Kritik daran, dass sie dem Wesen der Taufe als persönliches Glaubensbekenntnis widerspricht. Dieser Blog untersucht die Gründe, warum manche Christen die Säuglingstaufe als falsch ansehen und warum Gläubige diese Praxis sorgfältig prüfen sollten.
Biblische Grundlage für die Gläubigentaufe
Eines der Hauptargumente gegen die Säuglingstaufe ist der Mangel an expliziter biblischer Unterstützung für diesen Brauch. Das Neue Testament stellt die Taufe stets als einen Akt des Glaubens und der Reue dar. So sagt Petrus beispielsweise in Apostelgeschichte 2,38: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden; so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.“ Dieser Vers unterstreicht die Notwendigkeit der Reue, die Säuglinge weder begreifen noch ausdrücken können.
Ähnlich verhält es sich mit Markus 16:16, wo Jesus sagt: „Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“ Hier geht der Glaube der Taufe voraus, was bedeutet, dass die Taufe eine bewusste Entscheidung eines Menschen sein sollte, der den Glauben versteht und annimmt.
Jeder Taufe im Neuen Testament gehen Glaube und Buße voraus. So heißt es beispielsweise in Apostelgeschichte 8,12: „Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, Männer wie Frauen.“ Dieses Muster deutet darauf hin, dass die Taufe für diejenigen gedacht ist, die sich bewusst für die Nachfolge Christi entscheiden können, nicht für Säuglinge.
Die Bedeutung des persönlichen Glaubens
Die Taufe ist mehr als ein Ritual; sie ist ein öffentliches Bekenntnis zum Glauben und zur Nachfolge Jesu Christi. Dieser Aspekt der Taufe ist grundsätzlich persönlich und erfordert, dass der Einzelne die Bedeutung seiner Entscheidung versteht. Bei der Säuglingstaufe wird dieses persönliche Bekenntnis jedoch umgangen, da Säuglinge ihren Glauben weder begreifen noch artikulieren können.
In Römer 10,9-10 betont Paulus die Notwendigkeit eines persönlichen Glaubensbekenntnisses: „Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ‚Jesus ist der Herr‘ und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn wenn du mit dem Herzen glaubst, wirst du gerecht; und wenn du mit dem Mund deinen Glauben bekennst, wirst du gerettet.“ Diese Passage unterstreicht, dass Glaube und Erlösung eine Herzensangelegenheit sind, und untermauert damit die Vorstellung, dass die Taufe einer bewussten Glaubensentscheidung folgen sollte.
Die Rolle der Reue
Buße ist ein grundlegender Aspekt des christlichen Glaubens und eng mit der Taufe verbunden. Johannes der Täufer betonte in seinem Wirken Buße und Taufe als Akte der Abkehr von der Sünde und der Hinwendung zu Gott. In Matthäus 3,2 verkündet Johannes: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe.“ Dieser Aufruf zur Buße richtete sich an Menschen, die ihre sündige Natur erkennen und sich bewusst davon abwenden konnten.
Säuglinge besitzen jedoch nicht die kognitive Fähigkeit, Sünde zu erkennen oder Buße zu tun. Die Taufe eines Säuglings übergeht daher den wesentlichen Schritt der Buße, der für eine echte Bekehrung entscheidend ist. Ohne Buße verliert die Taufe ihren vollen Sinn und Zweck.
In Apostelgeschichte 3,19 wird dies noch weiter betont: „So tut nun Buße und bekehrt euch zu Gott, damit eure Sünden getilgt werden und Zeiten der Erquickung vom Herrn kommen.“ Dieser Aufruf zur Buße richtet sich an Menschen, die ihn verstehen und darauf reagieren können. Bei der Säuglingstaufe wird dieser entscheidende Schritt übersehen, wodurch der Akt unvollständig bleibt.
Historischer Kontext und Tradition
Die Praxis der Säuglingstaufe lässt sich bis in die frühen Jahrhunderte des Christentums zurückverfolgen und war maßgeblich von der Vorstellung der Erbsünde und dem Glauben geprägt, dass die Taufe diese Erbsünde reinwaschen kann. Viele Theologen argumentieren jedoch, dass diese Interpretation von der ursprünglichen Absicht und Praxis der Taufe, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, abweicht.
Die frühen Kirchenväter, wie Tertullian, äußerten Vorbehalte gegenüber der Kindertaufe. Tertullian, der im zweiten Jahrhundert schrieb, argumentierte, die Taufe solle verschoben werden, bis sich die Menschen bewusst zum Glauben bekennen könnten. Er erklärte: „Ein Aufschub der Taufe ist vorzuziehen, vor allem aber bei kleinen Kindern. Denn warum ist es notwendig, … dass auch die Taufpaten in Gefahr geraten? Denn sie könnten entweder durch den Tod ihre Versprechen brechen oder durch die böse Veranlagung eines Kindes getäuscht werden.“
Auch andere Kirchenväter, wie Gregor von Nazianz, plädierten dafür, die Taufe aufzuschieben, bis der Einzelne verstehen und eine bewusste Entscheidung treffen konnte. Gregor schrieb: „Hast du ein kleines Kind? Lass die Sünde ihren Höhepunkt erreichen. Lass es erst Christ werden, wenn es Christus erkennen kann. Warum eilt dieses unschuldige Alter der Vergebung der Sünden so schnell voraus?“
Verantwortlichkeit und spirituelles Wachstum
Ein weiterer Grund, warum die Säuglingstaufe als problematisch gilt, ist, dass sie ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln kann. Personen, die als Säuglinge getauft werden, könnten annehmen, automatisch Teil des christlichen Glaubens zu sein, ohne ein persönliches Verständnis oder Engagement. Dies kann das spirituelle Wachstum und die Verantwortlichkeit behindern, da die Person möglicherweise nie eine wahre Bekehrung erlebt oder eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus entwickelt.
Die Taufe, die aus einer persönlichen Entscheidung resultiert, ermutigt den Einzelnen, Verantwortung für seinen Glaubensweg zu übernehmen. Sie markiert den Beginn einer lebenslangen Verpflichtung, in Christus zu wachsen, die Heilige Schrift zu studieren und nach christlichen Grundsätzen zu leben. Die Säuglingstaufe hingegen fördert dieses Verantwortungsbewusstsein und die persönliche Verantwortung nicht.
Persönliche Verantwortung ist ein wesentlicher Aspekt des christlichen Glaubens. Philipper 2,12-13 rät Gläubigen: „Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ Dieser Prozess der Erarbeitung der eigenen Rettung ist ein fortwährender Prozess, der aktive Teilnahme und persönliche Verantwortung erfordert, die ein Kind nicht übernehmen kann.
Elterliche Verantwortung und Hingabe
Einige Befürworter der Säuglingstaufe argumentieren, sie stelle eine Hingabe des Kindes an Gott und die Absicht der Eltern dar, es im christlichen Glauben zu erziehen. Diese Absicht ist zwar lobenswert, kann aber durch eine Weihezeremonie effektiver umgesetzt werden als durch die Taufe. Durch die Weihe können Eltern ihr Kind der Fürsorge und Führung Gottes anvertrauen, ohne es voreilig in einen Bund einzuführen, den es nicht versteht.
Bei einer Taufe steht die Verantwortung der Eltern im Mittelpunkt, ihrem Kind den christlichen Glauben zu vermitteln und vorzuleben. Wenn das Kind heranwächst und ein Verständnisalter erreicht, kann es die persönliche Entscheidung treffen, Christus anzunehmen und sich taufen zu lassen. Dieser Ansatz respektiert die Fähigkeit des Kindes, seinen Glauben zu wählen, und stellt sicher, dass die Taufe ein sinnvoller und bewusster Akt ist.
Theologische Implikationen
Theologisch wirft die Kindertaufe Fragen über das Wesen von Glaube, Erlösung und Kirche auf. Betrachtet man die Taufe als notwendigen Schritt zur Erlösung, könnte die Kindertaufe suggerieren, Erlösung könne ohne persönlichen Glauben gewährt werden. Dies widerspricht den Lehren des Neuen Testaments, die den Glauben als Voraussetzung für die Erlösung betonen.
Darüber hinaus kann die Praxis der Säuglingstaufe die Grenzen zwischen Kirchenmitgliedschaft und persönlichem Glauben verwischen. Die Kirche soll eine Gemeinschaft von Gläubigen sein, die sich bewusst für die Nachfolge Christi entschieden haben. Durch die Taufe von Säuglingen kann die Kirche unbeabsichtigt auch Menschen einbeziehen, die sich noch nicht persönlich zum Glauben bekannt haben.
Abschluss
Obwohl die Säuglingstaufe in vielen christlichen Konfessionen eine lange Tradition ist, gibt es zwingende Gründe, ihre Gültigkeit zu hinterfragen. Die biblische Grundlage der Taufe betont persönlichen Glauben, Reue und bewusste Hingabe, die Säuglinge nicht zum Ausdruck bringen können. Darüber hinaus kann diese Praxis ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und das spirituelle Wachstum behindern.
Gläubige sollten die Heilige Schrift sorgfältig prüfen und die Bedeutung des persönlichen Glaubens und der Reue im Zusammenhang mit der Taufe bedenken. So können sie sicherstellen, dass die Taufe ein bedeutungsvoller und transformierender Ritus bleibt, der die aufrichtige Verpflichtung zur Nachfolge Jesu Christi widerspiegelt. Die Entscheidung für die Gläubigentaufe respektiert die Fähigkeit des Einzelnen, seinen Glauben zu wählen, und stellt sicher, dass der Akt der Taufe eine wahrheitsgetreue Widerspiegelung einer persönlichen und bewussten Entscheidung für den christlichen Glauben ist.